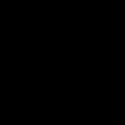Der traurige Tuiuiú
Wenn der Besucher im spätnachmittäglichen gelb-orangenen Zwielicht, kurz vor Untergang der Sonne, durch jene von vielen tausend Seen und Lagunen durchbrochene Tiefebene streift, die von den Einheimischen Pantanal genannt wird, dann verfällt er unwillkürlich dem besonderen Zauber dieser Stunde und der ihn umgebenden Landschaftsidylle. Soweit seine Augen reichen, kann er unzählige Vertreter der unterschiedlichsten Tierarten beobachten, in Gruppen über die Wasseroberflächen, die Grassavannen und die niedrigen Bäume des Galeriewaldes verteilt, der die Flüsse säumt: Hunderte von Kaimanen räkeln sich auf dem Ufersand, riesige Wasservögel stolzieren furchtlos zwischen ihnen herum, Wasserschweine geniessen in Herden die letzten Sonnenstrahlen. Auf den ausladenden Ästen am Flussufer turnt eine Gruppe von Brüllaffen herum – deutlich kann man die hellbraunen weiblichen Tiere von den tief schwarz behaarten Männchen unterscheiden, deren gutturaler Chor, wie fernes Donnergrollen, den morgendlichen Sonnenaufgang oder Veränderungen des Klimas anzukündigen pflegt. Die feuchtwarme Luft schwirrt und sirrt von Singvögeln und Insekten aller Art – vom Horizont flattert eine Gruppe Aras, von der sinkenden Sonne goldumrandet, heran, man kann die einzelnen Paare unterscheiden, die ein Leben lang zusammen bleiben – laut krächzend streben sie ihren gewohnten Schlafbäumen zu.
Zwischen den vielen Säugetieren, Reptilien und Vögeln macht man leicht auch den Wappenvogel des Pantanal aus – den Jabirú oder Tuiuiú, wie er, je nach Region, von den Einheimischen genannt wird. Er fällt auf durch seine überdurchschnittliche Grösse – eine Scheitelhöhe fast wie ein Mensch – und durch seine enorme Flügelspanne. Besonders in dieser Spätnachmittagsstunde stehen die Riesenvögel, in der Regel einzeln, mit hängenden Flügeln und gesenktem Kopf zwischen den anderen geschäftig umher kriechenden, stelzenden, flatternden und kletternden Tieren herum, sodass man bei ihrem Anblick unwillkürlich an trauernde menschliche Gestalten erinnert wird. Dösend, die meisten nur auf einem Bein, bewegen sie nicht ein einziges Mal den langen, schwarz gefärbten Hals oder die weiss befiederten Flügel – reglos, wie ausgestopft für ein Museum.

In den mondhellen Nächten der Flut, wenn Lagunen und Seen zwischen Februar und März bis zum Rand mit Wasser gefüllt sind, kann man den Tuiuiú am Ufer beobachten, wie er von einer Seite zur anderen marschiert und seine Flügel nur bewegt, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren – wie ein Wächter seines Wohngebiets, bedächtig und scheinbar in Gedanken versunken. Ausserhalb der Fortpflanzungsperiode lebt er meistens allein, und wenn sich ein Störenfried in seinem Gebiet zeigt, erklärt er ihm den Krieg und verteidigt sein Revier mit Nachdruck. Und hat man Gelegenheit, diesen kuriosen Vogel endlich einmal beim Starten oder Landen zu erleben, so gehört diese Beobachtung zweifellos zu den schönsten Erinnerungen: Er braucht dafür eine Start- oder Landepiste, wie ein kleines Flugzeug, denn um den 8-10 Kilogramm schweren Körper in die Luft zu kriegen, müssen die langen Beine den weit ausladenden Schwingen einen ordentlichen Auftrieb verschaffen – und beim Landen federt dasselbe „Fahrwerk“ den Körper ab und lässt ihn „ausrollen“. Ob solcher Anstrengungen zieht der Tuiuiú es allerdings vor, weniger bedrohlichen Annäherungen zu Fuss aus dem Weg zu gehen und verlässt sich dabei vorzugsweise auf seine langen schwarzen Beine. Wer ihn jedoch im Flug gesehen hat – wie er majestätische Kreise über einer Lagune zieht oder im Sonnenuntergang mit bedächtigem Flügelschlag seinem Horst zustrebt, der wird dieses bezaubernde Schauspiel sicher nicht so schnell vergessen.
Um die scheinbare Einsamkeit und mystische Tristesse des Tuiuiú rankt sich eine Legende, die sich die Borôro-Indianer des Mato Grosso heute noch erzählen: Mandi war ein junger Krieger der Paiaguá-Indianer, der eines Tages mit allen heiligen Tabus seines Stammes brach, um sich in seiner Liebe zu Ituna zu verlieren, der schönsten Jungfrau des benachbarten Xané-Volkes, das von den Paiaguá eher verächtlich behandelt wurde, denn seine Krieger waren den ihren nicht gewachsen – aber ihre Frauen waren von grosser Anmut.
Mandis Vater Cariú, der grosse, betagte Häuptling der Paiaguá, hatte vor, seinen erstgeborenen Sohn zu seinem Nachfolger zu ernennen, und deshalb, so sagte der heilige Medizinmann, könne er einer Heirat des Häuptlingssohns erst nach Ablauf von insgesamt fünf Monden zustimmen – nachdem er vom Vater die Kriegskeule und das Feder-Diadem der Häuptlingswürde erhalten hätte. Doch Mandi dauerte das viel zu lange – und nachdem er das Wasser der Heiligen Lagune konsultiert hatte, wusste er nur zu gut, wie lange es allein bis zum ersten Mondaufgang dauern würde – er konnte nicht warten bis nach dem fünften. Er wollte lieber die Häuptlingswürde verlieren als die Liebe der Frau, die ihm vom grossen Gott Tupã aus dem Himmel geschickt worden war, um sein Herz auf Erden zu erfreuen. Alle Bitten und Drohungen des verzweifelten, kranken Vaters fruchteten nichts, bis dieser, in einem plötzlichen Ausbruch von Zorn und Enttäuschung, sich gegen seinen Sohn wandte und einen fürchterlichen Fluch gegen ihn schleuderte.
Ungeachtet dessen fuhr Mandi fort, an jedem Nachmittag, den Tupã werden liess, sich mit seiner geliebten Ituna am Ufer der Heiligen Lagune zu treffen – dort verweilten sie viele Stunden, bis die Sonne sich mit einer letzten blutroten Spur am Horizont verabschiedete.
Aber sie waren eigentlich nie ganz allein an ihrem Lieblingsplatz.
Ein grosser Vogel von schneeweissem Gefieder, den Hals eingerollt und auf einem der Stelzenbeine dösend, war immer dabei. Und die zwei machten sich einen besonderen Spass daraus, dem handzahmen Tier kleine Muscheln und Schnecken zu reichen, deren Gehäuse sie zwischen zwei Steinen für ihn aufschlugen. Vorsichtig, und mit einer ihm eigenen Eleganz, nahm der kuriose Vogel die Leckerbissen aus den Händen seiner neuen Freunde, indem er die Spitze seines gewaltigen Schnabels wie eine Pinzette benutzte. Die drei wurden unzertrennlich. Der Tuiuiú stellte sich bereits am Vormittag an der Lagune ein, stelzte auf und ab, fischte ein bisschen zwischen den Wasserlinsen und wartete auf das Eintreffen seiner beiden Freunde und der Leckerbissen, die sie stets für ihn aufschlugen – und zum Schluss sahen sie sich alle drei zusammen den Sonnenuntergang an.

An einem dieser Nachmittage jedoch, zogen dichte Wolken auf, die sich über der Lagune auftürmten und die Hütten der Paiaguá in ein nebliges Halbdunkel hüllten, wie zur Ankündigung eines furchtbaren Unwetters. Das langsam heranrollende Grollen des Donners löste diesmal unter den Menschen Bestürzung und auch Angst aus: Cariú, ihr grosser Häuptling, der einstmals gefürchtete Krieger, lag im Sterben – die Schatten der ohne Sonnenuntergang einbrechenden Nacht senkten sich langsam, aber unabwendbar, über sein Haupt. Ab und zu zerriss ein greller weisser Blitz die vollkommene Schwärze. Der Medizinmann betete, mit gefalteten Händen, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, leise vor sich hin – Frauen und Kinder folgten seinem Beispiel.
Als er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging, liess Cariú seinen Sohn Mandi zu sich rufen und übergab ihm Keule und Feder-Diadem – ohne noch etwas zu sagen, verschied er. Die Klageweiber warteten bereits im Hintergrund, als Mandi zum Abschied die bronzefarbene, gefurchte Stirn seines Vaters mit den Lippen berührte – draussen begannen die Krieger des Stammes mit dem Totentanz. Rasch überquerte Mandi den Dorfplatz – kaum bemerkte er die Hoch-Rufe der anderen Mitglieder seines Volkes, die ihm als dem neuen Häuptling galten – ein paar Schritte den Dorfhügel hinab, und dann sah er sie, die dort am Ufer der Lagune trotz des Unwetters den ganzen Nachmittag ausgeharrt hatte. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte sie den Tuiuiú gefüttert, der sich ebenfalls von Donner und Blitz nicht hatte ins Bockshorn jagen lassen. Mandi schleuderte die Insignien seiner neuen Häuptlingswürde achtlos ins Dickicht und schloss seine Geliebte in die Arme.
Als die beiden Liebenden im Begriff waren, sich in dieser Nacht endlich der Sehnsucht nach dem Körper des andern hinzugeben, zuckte ein Blitzstrahl aus den schwarzen Wolken und traf die Stirn des jungen Mannes – eng umschlungen von seiner Geliebten, erfüllte sich der Fluch des alten Häuptlings. Am nächsten Tag, schon spät am Nachmittag, fand der Medizinmann die beiden – schwarz verbrannt auf dem feuchten grünen Waldboden – ihre beiden Körper untrennbar umschlungen in tödlicher Umarmung. Und neben ihnen stand eifersüchtig der Tuiuiú, der nichts verstand und den Schnabel aufsperrte, um die gewohnten Leckerbissen von seinen beiden verkohlten Freunden zu empfangen.
Am gleichen Nachmittag legte eine Gruppe der Paiaguá zwei Gräber auf dem Land von Pendeja an, dem Vater von Cariú, jenem berühmten Häuptling, der damals seinen Stamm so heldenhaft gegen die Invasion der ersten Weissen verteidigt hatte und unter ihrem Kugelhagel gestorben war. Das eine Grab war bestimmt für den Leichnam des tapferen Cariú, das andere – angelegt am Ufer der Heiligen Lagune – um die beiden jungen Liebenden aufzunehmen, die in der Stunde ihrer sündhaften Vereinigung den Zorn des Tupã heraufbeschworen hatten, und von ihm durch einen Blitz erschlagen wurden.
Der Tuiuiú, traurig und unbeweglich, hatte alles miterlebt aber nichts verstanden. Und als die letzte Schaufel Erde auf das Grab der beiden Sünder gefallen, rannte er ein Stück am Ufer entlang, um genügend Auftrieb unter seine Schwingen zu bekommen – und segelte dann schwerfällig davon.
Aber jeden Nachmittag stellte er sich wieder ein. Stelzte umher und wartete, dass jemand ein paar Schnecken für ihn auf den beiden Steinen zerschlüge, die dort immer noch lagen. Er war halt daran gewöhnt. Aber als niemand mehr kam, um ihn zu füttern, zog er traurig den Kopf ein und liess seine Flügel hängen. Und niemand hat ihn mehr so fröhlich gesehen wie damals, als seine Freunde noch bei ihm waren.
Und noch viel später fielen ihm vor Trauer um seine Freunde an Hals und Kopf die Federn aus, die Haut färbte sich dort schwarz – und sein Kopf überzog sich mit tiefen Falten unter dem Gewicht seines Schmerzes. Trotz alledem liess er sich nicht unterkriegen. Jeden Nachmittag stand er da auf dem kleinen Grab, nur auf einem Bein, den Kopf gesenkt und die Augen zur Erde gerichtet, aus der hoffentlich eines Tages seine beiden geliebten Freunde wieder zu ihm heraufsteigen werden.