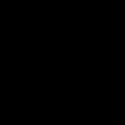Unter all den ungewöhnlichen und bewegenden Geschichten der Pantaneiros ist eine, die mich immer noch zwischen Mythos und Realität herumirren lässt, zumal ich immer wieder auf durchaus intelligente und offenbar gebildete Zeitgenossen unter den Viehzüchtern des Pantanals treffe, die darauf schwören, dass er existiert!
Gemeint ist der “Pai do mato“, so nennen sie ihn – der Vater des Waldes. Und diese Legende beherrscht die Phantasie von Fischern, Viehzüchtern und Bauern gleichermassen – nicht nur im Pantanal, sondern in den verschiedensten Regionen Brasiliens – und jeder erzählt sie ein bisschen anders. Die einen beschreiben ihn als ein Tier, das einem Menschen sehr ähnlich sieht, jedoch mit mächtigem Körperbau und von dichten, dunklen Haaren bedeckt, andere schildern ihn als eine Art animalischen Gnom, mit Ziegenfüssen und einem Körper wie dem eines Affen, aber einem Gesicht wie ein Mensch. Und es gibt welche, die ihn schon mehrmals gesehen haben und ihn als eine fremdartige, scheue Kreatur beschreiben, die auf einem Wildschwein reitet, plötzlich auftaucht und genauso plötzlich wieder verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen.
 Die Älteren sagen, dass diese kuriose Kreatur zwar niemandem ein Leid zufügt, jedoch stets die Fischer und Jäger in ihren Camps beobachtet und verhindert, dass sie mehr Fische fangen und mehr Tiere abschiessen, als sie für ihren Lebensunterhalt brauchen – im Fall solcher Exzesse, schleudert er Steine ins Wasser und macht Lärm im Wald, um die Fische und das Wild zu vertreiben. Andere berichten, dass er die Jagdhunde mit einer Bambusgerte schlägt, um das verfolgte Tier vor ihnen zu schützen. Im Nordosten Brasiliens sagen sie, dass es wohl möglich sei, ihn zu töten, aber die Kugel muss ihn an seiner einzigen Schwachstelle, dem Nabel, treffen, und der Schütze muss flink sein und schnell am Abzug, denn der “Pai do mato“ ist andauernd in Bewegung und verbirgt seine schwache Stelle geschickt.
Die Älteren sagen, dass diese kuriose Kreatur zwar niemandem ein Leid zufügt, jedoch stets die Fischer und Jäger in ihren Camps beobachtet und verhindert, dass sie mehr Fische fangen und mehr Tiere abschiessen, als sie für ihren Lebensunterhalt brauchen – im Fall solcher Exzesse, schleudert er Steine ins Wasser und macht Lärm im Wald, um die Fische und das Wild zu vertreiben. Andere berichten, dass er die Jagdhunde mit einer Bambusgerte schlägt, um das verfolgte Tier vor ihnen zu schützen. Im Nordosten Brasiliens sagen sie, dass es wohl möglich sei, ihn zu töten, aber die Kugel muss ihn an seiner einzigen Schwachstelle, dem Nabel, treffen, und der Schütze muss flink sein und schnell am Abzug, denn der “Pai do mato“ ist andauernd in Bewegung und verbirgt seine schwache Stelle geschickt.
Auf der Fazenda Santa Bárbara, im Pantanal, lernte ich während eines kurzen Aufenthalts Zé Pedro kennen, einen alten Rinderhirten mit sonnengegerbter Haut, in die die Zeit tiefe Furchen gegraben hatte. Er war von mittelgrosser Statur, einem muskulösen Torax und ebensolchen Armen und seine linke Gesichtshälfte war entstellt durch eine ziemlich grosse Narbe, die ihm ein halbwilder Stier einst zugefügt hatte – das war vor zwanzig Jahren.
Ich war auf dem Weg zur Fazenda Santa Bárbara, um den Besitzern mal wieder ins Gewissen zu reden und ihnen den Unterschied zwischen Viehzucht und Tourismus zu erklären – ich meine natürlich den wirtschaftlichen Unterschied und der zu erzielenden Einnahmen. Die Santa Bárbara liegt so an die 220 Kilometer von Cáceres entfernt, und ich steuerte einen kleinen Suzuki-Jeep auf einer Pantanal-Piste voller Hindernisse – zum einen voller Sandgruben, dann wieder unterbrochen von Wasserlöchern, ausserdem Dutzende von Weidetoren, die unterwegs geöffnet und wieder geschlossen werden mussten – eine stundenlange Tortur.
Es war im Monat Juli und einer klaren Vollmondnacht, als ich nach der ermüdenden Anfahrt endlich die Fazenda erreichte. Etwas abseits vom Hauptgebäude brannte ein offenes Feuer und die “Peões“ (Fazenda-Angestellte) hatten sich rundherum zu einem Churrasco nach Pantanal-Manier niedergelassen, zu dem sie mich wie selbstverständlich einluden. Das Fleisch wird gegart, indem man es nur mit grobem Salz würzt, auf Spiesse aus frischem Holz aufzieht, die man rings um die Glut, etwas angeschrägt, in den Boden steckt. Die Leute sitzen auf niedrigen Bänkchen oder direkt auf dem Boden und unterhalten sich über die Erlebnisse des Tages oder lauschen einer Geschichte, die das Leben schrieb, und die von einem talentierten Erzähler vorgetragen wird. Was dabei nicht fehlen darf, ist der “Tereré“, grüner Mate-Tee, der von den Pantaneiros eiskalt getrunken wird – im Gegensatz zum “Chimarrão“ der Gaúchos, den man mit kochendem Wasser aufgiesst.
Während der Tage, die ich auf der Fazenda verbrachte, sympathisierte ich besonders mit einem der “Vaqueiros“ (Rinderhirten), demselben, der mich direkt nach meiner Ankunft empfangen und zum Churrasco eingeladen hatte. Noch am selben Abend hatte der schon stark abgenutzte, lederne Revolvergurt um seine Hüfte meinen Blick auf sich gezogen, aus dem der mit Perlmutter besetzte Griff eines antiken Revolvers ragte. Noch hielt ich mich zurück, aber ich interessierte mich sehr zu erfahren, um welche Waffe es sich handelte. Die Anwort bekam ich dann einen Tag später, nachdem man mir den Mann als “Zé Pedro“ vorgestellt hatte, der als “Capataz“ die Arbeit der Vaqueiros überwachte.
Wieder sitzen wir in Gruppen ums Feuer, und nach ein paar Runden Tereré zieht Zé Pedro den Revolver aus dem Halfter, verschiebt einen kleinen Hebel, der den Lauf wie bei einem Gewehr öffnet und die Trommel freilegt, kippt dann die Waffe nach unten, bis die sechs grossen Patronen in seine linke Hand fallen – und übergibt mir den leeren Revolver zu einer ausgiebigen Inspektion. Ich halte einen antiken 44er Colt von Smith & Wesson in meinen Händen, eine echte Waffe des amerikanischen Wilden Westens, äusserst gepflegt und in bestem Zustand, den alle Vaqueiros der Fazenda den “Chimitão“ (“Chimi“ von Schmitt – “tão“ ist eine Vergrösserungsform) nennen.
Zé Pedro erzählt mir dann, dass diese Waffe einst seinem Vater gehört hat, einem brasilianischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg dabei war und den Revolver aus Europa mitbrachte. Als er pensioniert wurde, kaufte er sich ein bisschen Land im Pantanal und zog um – hier baute er sich ein Häuschen und wurde als geschickter Viehtreiber bald bekannt in der ganzen Region, besonders auch als mutiger Jaguar- und Wildschweinjäger. Sein Name war José Bento, aber alle kannten ihn nur als “Zé Bento“, als Draufgänger und guten Schützen, der die grossen Katzen nicht fürchtete und nur mit seinem Revolver zur Strecke brachte. Man sagt, dass er seinen Revolvergurt niemals ablegte, auch nicht zum Schlafen.
Zé Bento tötete alle möglichen Tiere zu jener Zeit. Selbst ein männlicher Büffel brach in die Knie, als der 44er Chimitão Feuer spuckte, aber es war die Jagd auf die “Onça“, den Jaguar, bei der Zé Bento seinen aussergewöhnlichen Mut bewies. Eines Tages verfolgte er eine dieser Raubkatzen, die sich vor dem Ansturm seiner Hunde in ein dichtes Gewirr von Lianen verkrochen hatte. Zé Bento musste sich den Weg mit der Machete bis in ihre Nähe bahnen – als er nur noch fünf Meter von der “Onça“ entfernt war, und sie ihn erblickte, liess sie von den Hunden ab, um ihn anzufallen, trotz der hinderlichen Lianen gelang es ihm, seine Waffe zu ziehen und die Raubkatze mit vier Schüssen zu erledigen – bereits im Sprung war sie tot und fiel auf ihn. Ein andermal, in Begleitung seines Freundes Tonhão, traf dieser die “Onça“ mit seinem 38er Karabiner in die Brust, als sie dann noch lebend von der Astgabel stürzte, erwischte sie den Leithund “Leão“ mit ihren Krallen, und Zé Bento kam seinem Hund zu Hilfe, indem er ihn an einem seiner Beine packte und wegzog, während er mit der anderen Hand den Schädel der Raubkatze mit seiner Machete spaltete.
Solche Geschichten lösen allerdings in mir keine Bewunderung mehr aus für jene “Helden“, deren ungebremster Hass gegenüber dem “Raubzeug“, wie sie es nannten, letztendlich dafür verantwortlich war, dass Brasiliens Grosskatzen an den Rand der Ausrottung getrieben wurden. In eine unberührte Region, wie das Pantanal, in der einst die “Onças“ (Jaguare, Pumas und Jaguarundis) alleinige Herrscher an der Spitze der Nahrungskette waren, fielen die Viehzüchter ein mit ihren Herden und der Idee, auf dem durch die jährliche Flut sich stets erneuernden Gras der Savannen ihre Herden zu mästen und zu vermehren – mit wenig Arbeitsaufwand und ohne grosse Investitionen. Zwar vertrugen sich die Rinder mit den meisten Wildtieren, aber die Grosskatzen stellten sich von Hirsch und Tapir auf Kalbfleisch um, das ausserdem noch viel leichter zu erbeuten war. Und das war ihr Todesurteil.