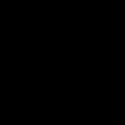Es war an einem Nachmittag des Jahres 1543 – einem denkwürdigen Tag für die Bewohner eines Xaraé-Dorfes, denn plötzlich sahen sie sich monströsen Ungeheuern gegenüber, die sahen aus wie riesige Hirsche (so berichteten sie später von ihrer Begegnung), enorm gross, aber ohne Hörner oder Geweihe. Ihr Gang hörte sich an wie das Schlagen vieler Trommeln – über ihre Körper verteilte Glöckchen machten ein Geräusch wie ein Heer von Klapperschlangen. Ihre Augen waren bedeckt, und trotzdem konnten sie sehen. Schweiss lief in Bächen an ihrem Hals herunter und über die Brust. Aus ihren Mäulern quoll dicker Schaum, während sie zwischen den Zähnen auf einem Stück Metall herumkauten. In keiner Überlieferung ihrer Vorfahren hatten die Indios je von der Existenz solcher Monster gehört.
Noch unglaublicher war, dass auf dem Rücken dieser fremdartigen Kreaturen Männer sassen, Bleichgesichter, deren Körper von oben bis unten mit buntem Zierrat bedeckt waren. Das ganze Dorf lief zusammen – Krieger, Kinder und alte Leute – um die Fremdlinge auf ihren Monsterhirschen zu bestaunen. Die versuchten ein Gespräch in Gang zu bringen – dafür hatten sie ein paar befreundete Indios mitgebracht, die stellten Fragen nach dem Boden, den Flüssen und dem Wasser. Sie zeigten ihnen Objekte aus Gold und Silber und hörten nicht auf zu fragen – aber die Xaraé beachteten sie gar nicht, ihre Augen und Ohren waren auf jene fremdartigen Kreaturen mit vier Beinen gerichtet, die so wie Hirsche, Gras frassen, während ihre Reiter versuchten, den Xaraé ein paar Auskünfte zu entlocken. Ein Krieger aus ihrer Mitte näherte sich vorsichtig. Der Reiter vor ihm gab ihm durch eine Geste zu verstehen, dass er sein Reittier anfassen sollte. Der Indio streckte seine Hand aus, und mit spitzen Fingern berührte er das Tier – dessen Fell zuckte bei der Berührung, und der Indio zog seine Hand erschreckt zurück. Lachend sagte der weisse Mann: “Caballo“!
Der Kommandierende jener Reitertruppe war der Spanier Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Seine Erkundungs-Expedition hatte drei Jahre zuvor in Santa Catarina begonnen, wo er mit vierhundert Mann und sechsundzwanzig Pferden in Richtung auf Assuncion, am Ufer des Rio Paraguay, marschierte. Unter anderem entdeckte er auf seinem Marsch auch die Iguaçu-Wasserfälle.

Im Land der Xaraés traf er auf eine scheinbare Unendlichkeit an Seen und Lagunen – am Ufer eines breiten Flusses, der die flache Landschaft durchquerte, war er auf das Dorf der Eingeborenen gestossen. Nach den Aufzeichnungen jener Epoche sollte er sich eigentlich vor, oder bereits innerhalb, eines riesigen Sees befinden, dem “Meer der Xaraés“ im Zentrum von Südamerika – eine Legende, die Jahrhunderte lang als Realität akzeptiert wurde. Lusitanier und die Bandeirantes aus São Paulo gaben der Region später den Namen “Pantanal“ (Sumpf) – eine Bezeichnung, die 1727 offiziell registriert worden war. Aber auch sie ist irreführend, denn in Wirklichkeit handelt es sich nicht um ein Sumpfgebiet, sondern eine Tiefebene, die von den Flüssen, die sie durchqueren, alljährlich zur Regenzeit überschwemmt wird.
Eigentlich war nicht der Mensch sondern das Pferd der Eroberer des Pantanals. Nachdem jener Cabeça de Vaca seine Abenteuer veröffentlicht hatte, folgten zahlreiche Europäer seinen Spuren ins Gebiet der Xaraés – und stets waren sie auf der Suche nach sagenhaften Schätzen. Während sie enttäuscht von ihren Abenteuern zurückkehrten oder gar ihr Leben bei Zusammenstössen mit feindlichen Eingeborenen verloren, überlebten viele verlorene Pferde ihre ehemaligen Besitzer und vermehrten sich in der neuen Umgebung. Im Süden des Kontinents züchtete die Bevölkerung von Buenos Aires eine neue Pferderasse, die so genannten “Caballos Cimarrones“, und zahllose wilde Pferde erreichten den Gran Chaco und das Pantanal – durch natürliche Verbreitung oder auch als Reit- und Lasttiere der Jesuiten aus den Guarani-Missionen. In freier Natur, auf natürlichen Weiden, entdeckten die einst zahmen Tiere den Weg zurück in die ungebändigte Freiheit der endlosen Savannen – von diesen Wildpferden der grossen Ebenen im Süden gibt es bis heute immer noch ein paar Herden – die Gaúchos nennen sie “Baguais“.
Auch Einheiten der “Bandeirantes“, aus dem Bundesstaat São Paulo, breiteten sich aus im Mato Grosso – sie waren auf der Suche nach Gold- und Silbervorkommen. 1593 zerstörten sie die spanische Mission Santiago de Xerez, in der Nähe des Rio Miranda. Erst ein Jahrhundert später begriffen sie, dass das begehrte “Eldorado“ der Indios bereits von den Spaniern in den Anden – in Minen wie Potosi (Bolivien) – entdeckt und ausgebeutet worden war. Doch endlich, im Jahr 1719, fand Pascoal Moreira Cabral auch Gold in Cuiabá (Mato Grosso), und zu seiner Förderung brauchte man zusätzliche Lieferungen von Pferden und Rindern – von denen nicht wenige ebenfalls zur Aufstockung der wild lebenden Herden beitrugen.
Obwohl das Pferd die Indios immer noch in Schrecken versetzte, gab es eine Ausnahme, das waren die Kadiwéu-Guaicuru. Dieses kriegerische Indio-Volk fing sich wilde Pferde ein, zähmte sie, benutzte sie als Transportmittel, als Reittiere zur Versklavung von Nachbarvölkern und zur Kriegführung gegen Portugiesen und Spanier gleichermassen. Wie der Jesuit und Naturalist José Sanchez Labrador berichtet, “benutzen die Guaicurus keine Sättel auf ihren Pferden, sie springen mit einem einzigen Satz auf deren Rückenfell“. Wie ein Kommandant der portugiesischen Grenztruppen (1781) sich ausdrückt, war es für sie ein Glück, dass sich die Guaicurus pro Attacke mit nur einem Opfer begnügten, “sonst wäre in Cuiabá nicht ein einziger Portugiese übrig geblieben“. Ein Friedensvertrag zwischen den Guaicurus und der portugiesischen Krone wurde dann 1791 unterzeichnet. Im verlustreichen Paraguay-Krieg (1864) kämpften diese berittenen Indios in einem Pantanal-Regiment zur Verteidigung von Mato Grosso.
Mit der Eroberung des Pantanals entstand aus den wilden Pferden eine neue Rasse. Der gegenwärtige “Cavalo Pantaneiro“ hat eine anerkannte Herkunft, Ergebnis aus verschiedenen Kreuzungen lusitanischen Ursprungs (Berber, Andalusier), des Arabers und des argentinischen “Criolo“ – unter dem Druck einer natürlichen Auslese, bei der die Dynamik des Wassers massgebend gewesen ist. Es handelt sich dabei um den einzigartigen Fall eines “amphibischen“ Pferdes!
 Sehr früh lernt das Pantanalpferd sein Leben an die saisonalen Überschwemmungen anzupassen. Die Kapazität an Muttermilch im Euter der Stuten ist sehr begrenzt. Im Gegensatz zu einem Kalb, das am Euter des Muttertieres nur wenige Male am Tag trinkt, saugt das Fohlen andauernd, wann immer es Gelegenheit dazu bekommt. Und daher begleitet es die Mutter, wo immer sie hingeht, auf Schritt und Tritt – und lernt so alle Überlebenstricks schon sehr früh. Die Mehrheit der Fohlen erblickt das Licht der Welt bei Hochwasser. Von Anfang an staksen sie im Wasser herum, in Tageshitze und nächtlicher Kälte, sie lernen schwimmen und, vor allem, wie man unter Wasser grast und dabei die Luft anhält.
Sehr früh lernt das Pantanalpferd sein Leben an die saisonalen Überschwemmungen anzupassen. Die Kapazität an Muttermilch im Euter der Stuten ist sehr begrenzt. Im Gegensatz zu einem Kalb, das am Euter des Muttertieres nur wenige Male am Tag trinkt, saugt das Fohlen andauernd, wann immer es Gelegenheit dazu bekommt. Und daher begleitet es die Mutter, wo immer sie hingeht, auf Schritt und Tritt – und lernt so alle Überlebenstricks schon sehr früh. Die Mehrheit der Fohlen erblickt das Licht der Welt bei Hochwasser. Von Anfang an staksen sie im Wasser herum, in Tageshitze und nächtlicher Kälte, sie lernen schwimmen und, vor allem, wie man unter Wasser grast und dabei die Luft anhält.
Während sechs bis acht Monaten stehen die Weideflächen im Pantanal unter Wasser. Um mit dem Kopf unter Wasser grasen zu können, hat das Fohlen Atemübungen machen müssen, die seine Brust im Lauf der Zeit geweitet haben. Die überlegene Brustmuskulatur macht es zu einem Tier mit “frontaler Zugkraft“. In seiner aussergewöhnlichen Gangart schiebt es den Körper nicht mit den Hinterbeinen nach vorn, wie die anderen Pferde das tun, sondern zieht ihn mit den Vorderbeinen. Und das ist ein grosser Vorteil im Schlamm und den Sumpflöchern des Pantanals. Seine breiten, beweglichen Nüstern werden fast durchsichtig in Momenten grösster Anstrengung – ein weiteres Zeichen seiner ungewöhnlichen Atmungskapazität.
Von kleinem Wuchs, genügsam, widerstandsfähig, mit breiter Brust und schmalem, abfallendem Rücken, ist das Pantanal-Pferd in seiner Gestalt so ziemlich das Gegenteil equestrischer (Equestrik = Reitkunst) Schönheit. Das Wasser des Pantanals verwandelt seine scheinbaren Fehler jedoch in unvergleichliche Vorzüge bei der Aufzucht und der Kontrolle der Rinderherden. Und wenn sein Schwanz beim Galoppieren im Wind weht, dann erinnert er an die Eleganz seiner Berber- und Arabervorfahren.
Sein Herr und Meister ist der “Peão“ – man könnte ihn als einen Cowboy des Pantanals bezeichnen – und der pflegt eine besondere Beziehung zu seinem Pferd, die man ohne Übertreibung als “innige Freundschaft“ bezeichnen kann. Im Gegensatz zur Landwirtschaft, zur Mineralienförderung oder der Arbeit im Haushalt, wurden in historischer Zeit bei der Aufzucht von Rindern kaum Sklaven eingesetzt, denn die extensive Viehzucht konnte nur von freien Männern betrieben werden, die sich oft lange Zeit bei den Herden aufhielten oder sie zu weit entfernten Marktplätzen treiben mussten. Sklaven wären wahrscheinlich nicht zurückgekommen – und die Rinder auch nicht.
Die besondere Dynamik der Pantanal-Überschwemmungen öffnet und verschliesst Wege, erweitert und verkürzt Entfernungen, schafft neue Weideflächen oder bedeckt sie. Und in der Einsamkeit der Fazendas, umgeben von weiten Savannen, gestaltet sich das einfache Leben der Menschen zwischen ihren Herden und nach den Regeln der vereinzelten, oft mehrere Tagesritte entfernten, Nachbarschaft. Alle Menschen und alle Tiere – auch die wilden – dürfen sich zwischen den einzelnen Fazendas (Grundbesitztümern) frei bewegen. Für die Menschen gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Ein geschlossenes Tor (einer Umzäunung) muss wieder geschlossen werden – ein offenes Tor muss offen bleiben. Wenn Reiter oder Fahrzeuge einander begegnen, drehen sich die Fragen meist um das Wasser: Kommt man an dieser oder jener Stelle noch durch? Ist das Wasser schon soweit gesunken, dass man den alten Vieh-Trail wieder benutzen kann?

Die Pantanal-Cowboys verfolgen das Steigen und Fallen der Wasserflut mit grösster Aufmerksamkeit. Steigt der Wasserspiegel, schwingen sie sich auf ihre Pferde und treiben die Rinder auf ein höher gelegenes Terrain – die “Cordiheiras“ (Hügelketten). Sie schützen die Tiere vor eventuellem Versinken im Morast und vor Angriffen durch Grosskatzen, und sie behandeln ihre Verletzungen. Bei grösseren Überschwemmungen, vom Hochwasser eingeschlossen, hängt das Überleben der Rinder allein von den erfahrenen „Peões“ und ihren zuverlässigen Pferden ab.
Die Pantanal-Rinder – sie werden auch als “Tucuras“ oder “Cuiabanos“ bezeichnet – stammen von der Rasse “Taurina“ ab, die im 16. Jahrhundert aus Europa eingeführt wurde. Aufgrund natürlicher Selektion und eine sorgsame Behandlung durch ihre Züchter, sind sie gegen die üblichen Rinderkrankheiten immun und besonders resistent gegen die Klimaschwankungen ihrer Umgebung, die zwischen den heissesten Tagen des Sommers und den kältesten Nächten des Winters – in denen sogar Frosteinbrüche nicht selten sind – Temperaturdifferenzen von fast 400C erreichen können.
 Ausserdem sind diese Rinder an das Abweiden der verschiedensten Grassorten gewöhnt, deren Geschmack und nutritive Qualität zwischen der Trockenzeit und der Überschwemmungsperiode grossen Schwankungen unterworfen sind. Und sie überleben auch Perioden, in denen es an adäquatem Futter fehlt. Diese Eigenschaften hat man mit der Einführung der indischen Zeburasse, und durch Kreuzungen während des 20. Jahrhunderts, bewahren können. Im Vergleich mit anderen Herden Brasiliens sind Produktivität und Rentabilität der Pantanal-Rinder eher gering, aber sie spielen eine bedeutende Rolle in der Erhaltung ihres Lebensraumes.
Ausserdem sind diese Rinder an das Abweiden der verschiedensten Grassorten gewöhnt, deren Geschmack und nutritive Qualität zwischen der Trockenzeit und der Überschwemmungsperiode grossen Schwankungen unterworfen sind. Und sie überleben auch Perioden, in denen es an adäquatem Futter fehlt. Diese Eigenschaften hat man mit der Einführung der indischen Zeburasse, und durch Kreuzungen während des 20. Jahrhunderts, bewahren können. Im Vergleich mit anderen Herden Brasiliens sind Produktivität und Rentabilität der Pantanal-Rinder eher gering, aber sie spielen eine bedeutende Rolle in der Erhaltung ihres Lebensraumes.
Während der Trockenperiode führt das Abfliessen des Wassers zur Erneuerung des Grüns auf den Weiden – es wird von den Rindern gefressen. Das vom heranwachsenden Gras der Atmosphäre entzogene Kohlendioxyd wird von den Rindern in Fleisch verwandelt und kehrt, teilweise, zurück in die Atmosphäre als Methangas – produziert von den Bakterien im Verdauungssystem der Rinder. Durch den Rückgang der Viehzucht in bestimmten Regionen des Pantanals, wird das Gras nicht mehr abgeweidet. Und das ist eine schlechte Nachricht.
Denn die Rinder sind auch die “Feuerwehr“ des Pantanals. Mit dem Verzehr der Vegetation verhindern die Tiere, dass sie zu Heu und Stroh vertrocknet, sich das Gras in hoch entzündliches Material verwandelt. Die Reduzierung der Herden verursacht also einen gefährlichen Rückstand von trockenem Gras und einer Zunahme von Flächenbränden – und mit dem Feuer werden verstärkte Emissionen von Methan und Kohlendioxyd in die Atmosphäre abgegeben, die den Treibhauseffekt auf unserem Planeten weiter ankurbeln. Wenn das Gras dagegen nicht abbrennt, wird es noch schlimmer. Vom Wasser der Überschwemmungsperiode bedeckt, verfault es, wodurch ein grosser Anteil seiner organischen Materie sich in Methangas verwandelt.
Seit mehr als dreihundert Jahren haben Rinder und Pferde die Vegetation des Pantanals verändert und damit ein neues ambientales Gleichgewicht geschaffen. Die Region ist anerkannt als “Erbe der Menschheit“ durch die Unesco, mit dem Ziel, das Erbe jener kulturellen Werte der Vergangenheit zu bewahren. Ausser der unvergleichlichen Fauna und Flora in diesem Reich der steigenden und fallenden Wasser, gehören zu seinen besonderen Schätzen auch die spezialisierten Pferde, die resistenten Rinder und der Mensch des Pantanals – mit seinem ganzen kulturellen und ökologischen Vermächtnis.